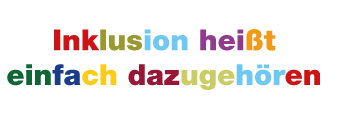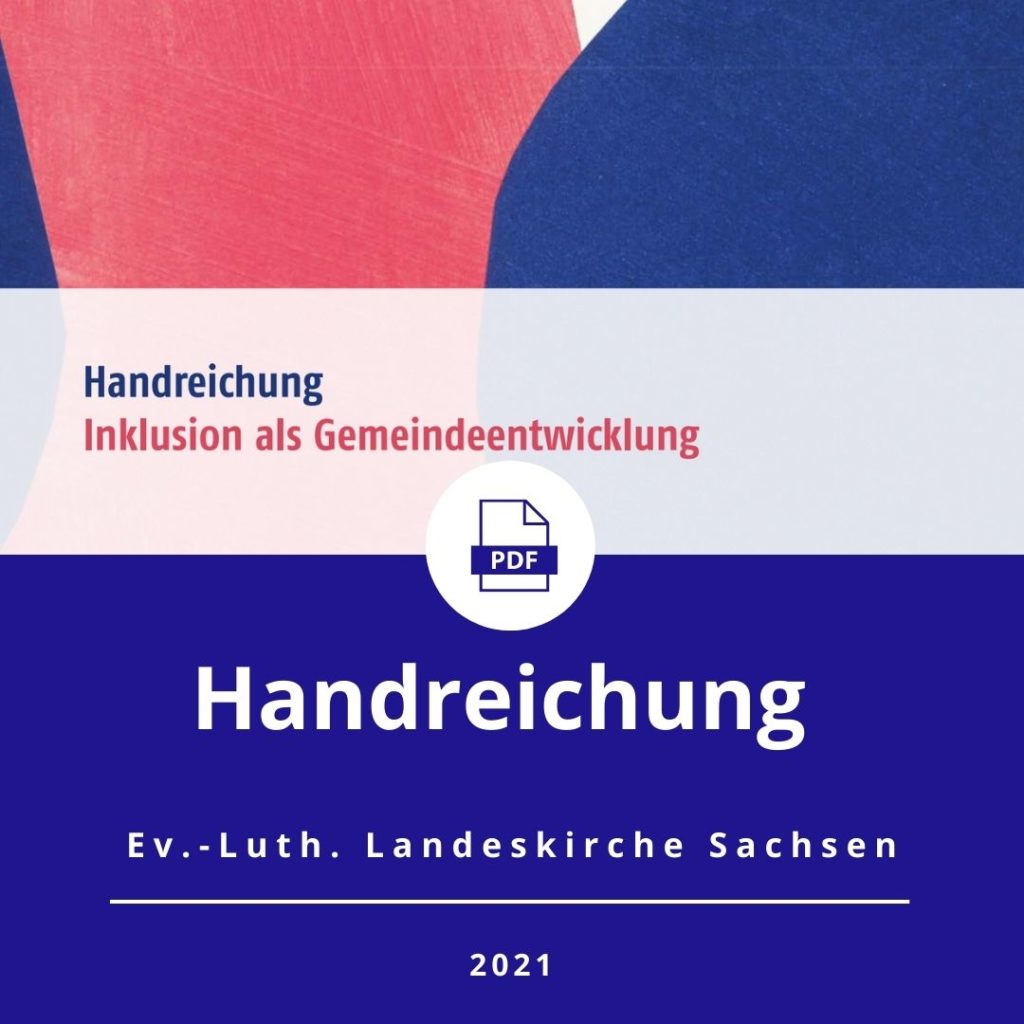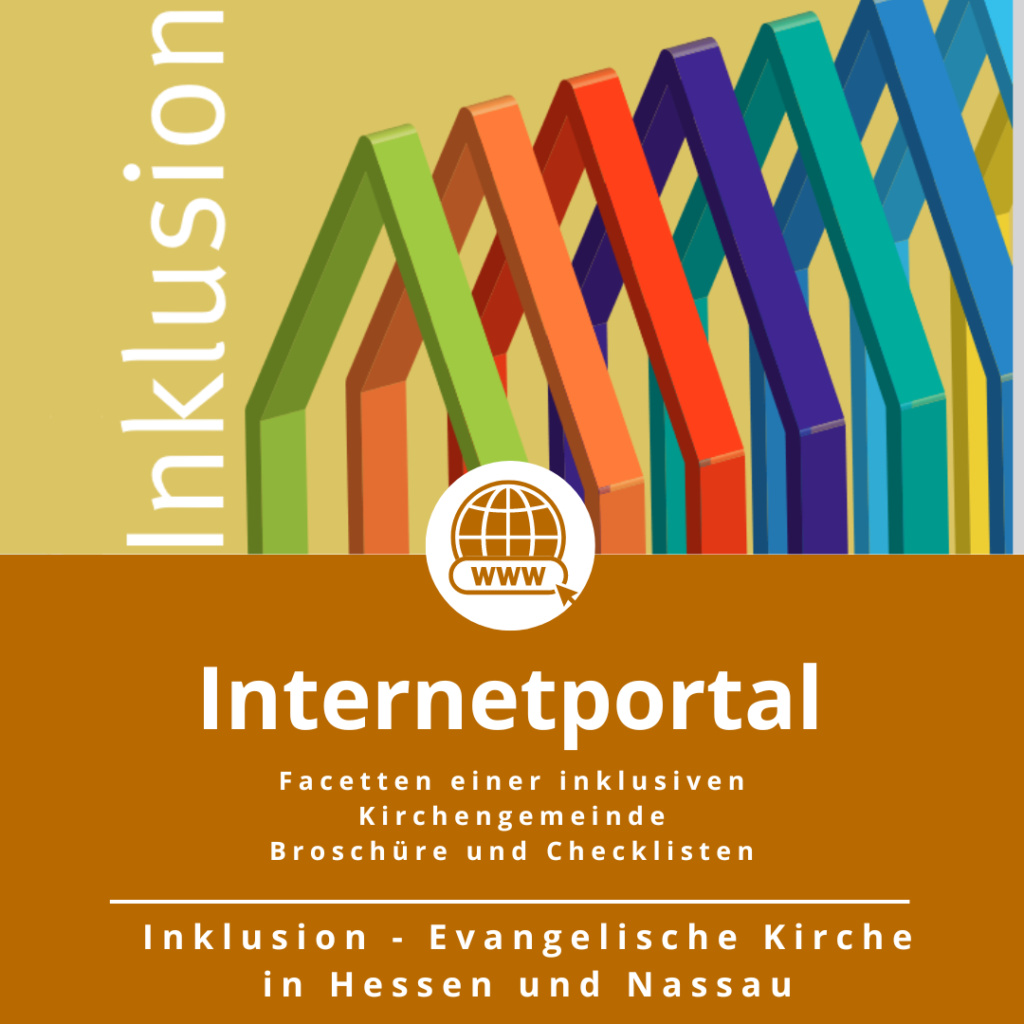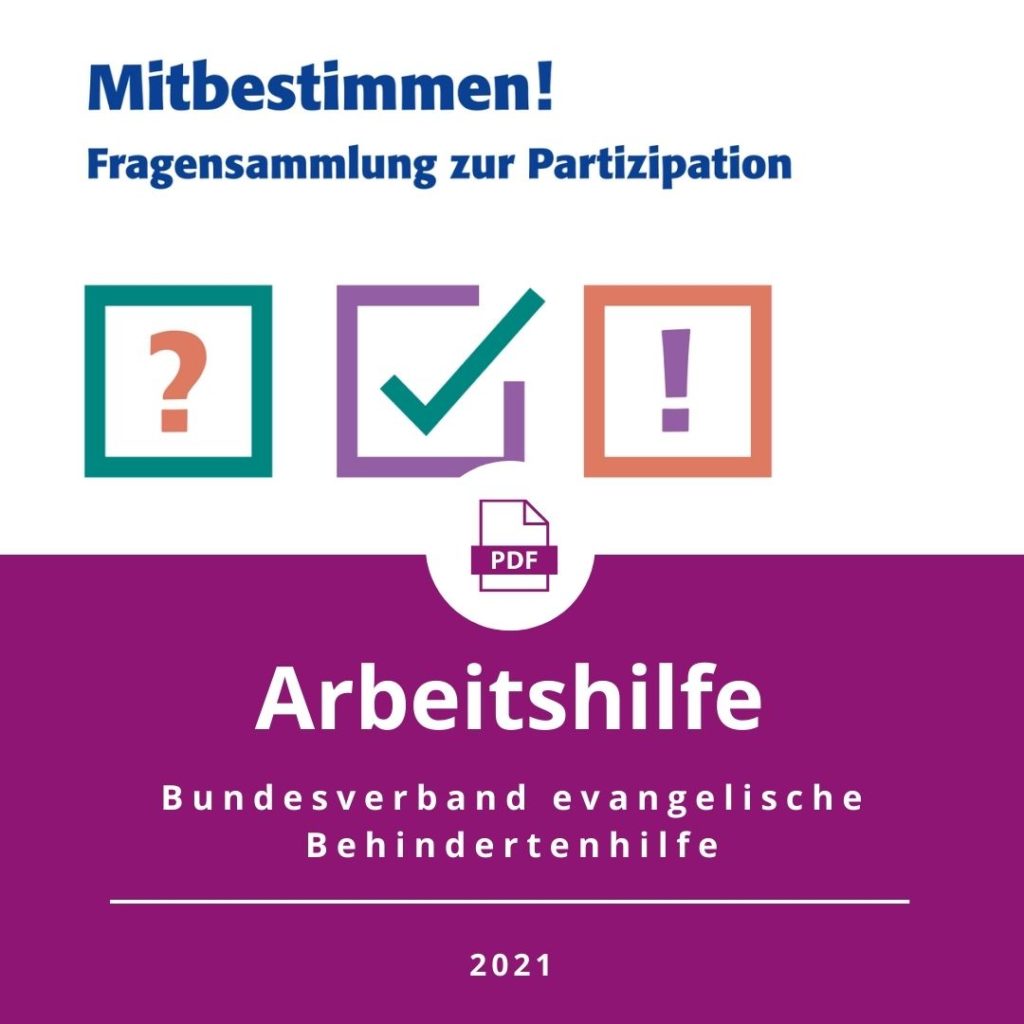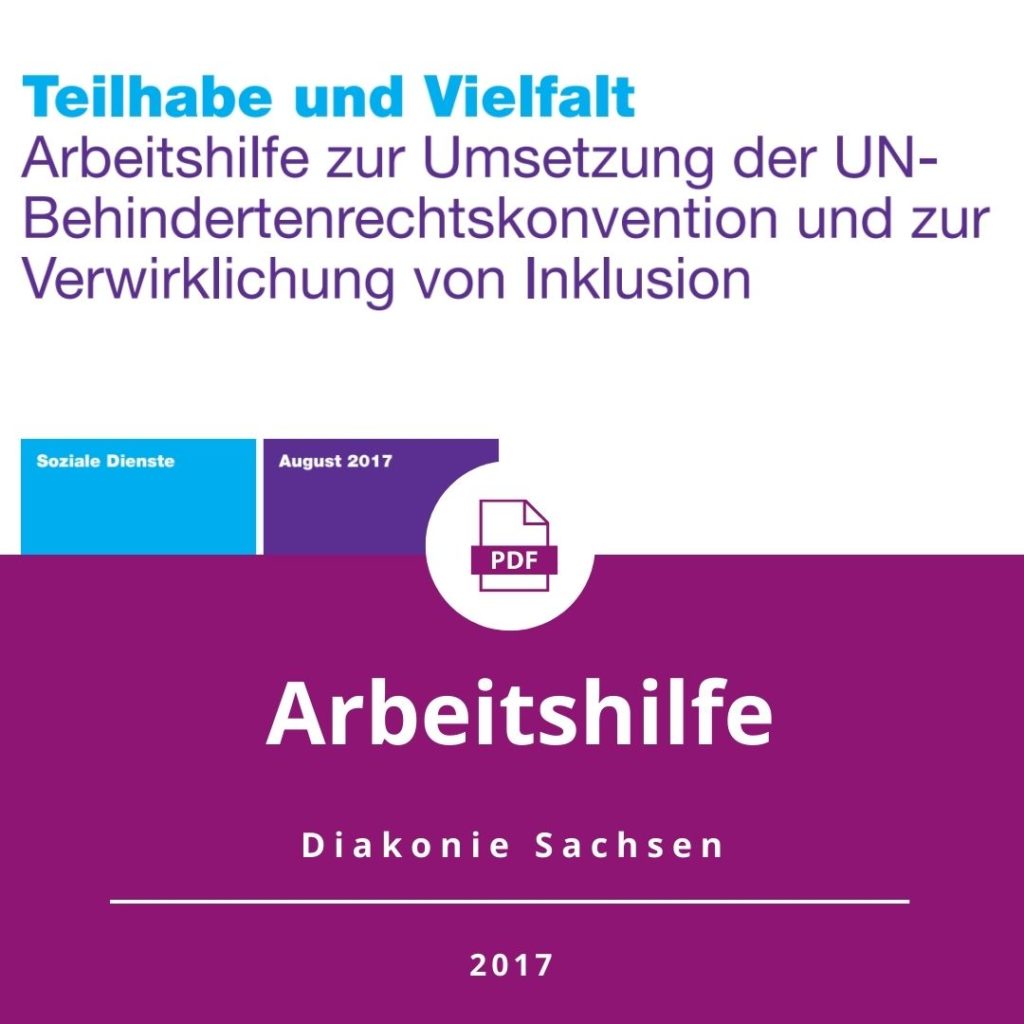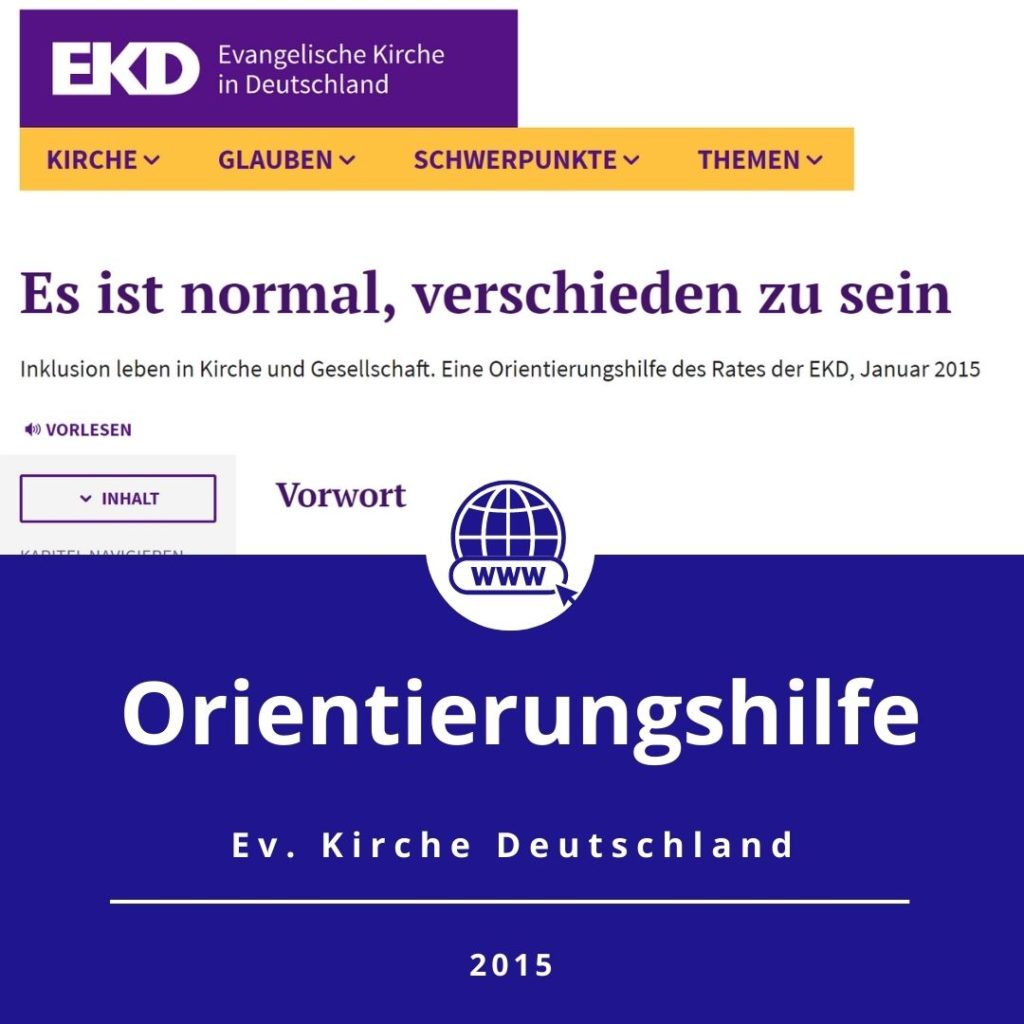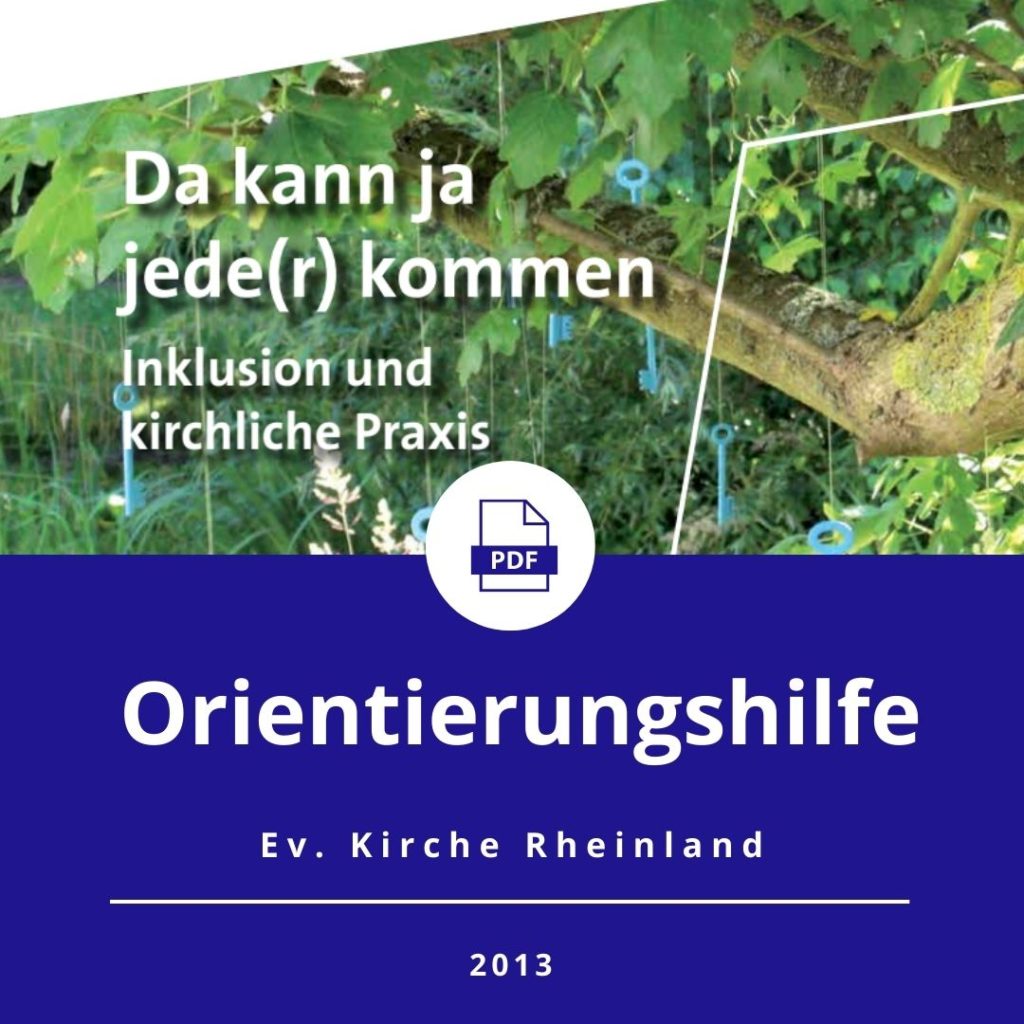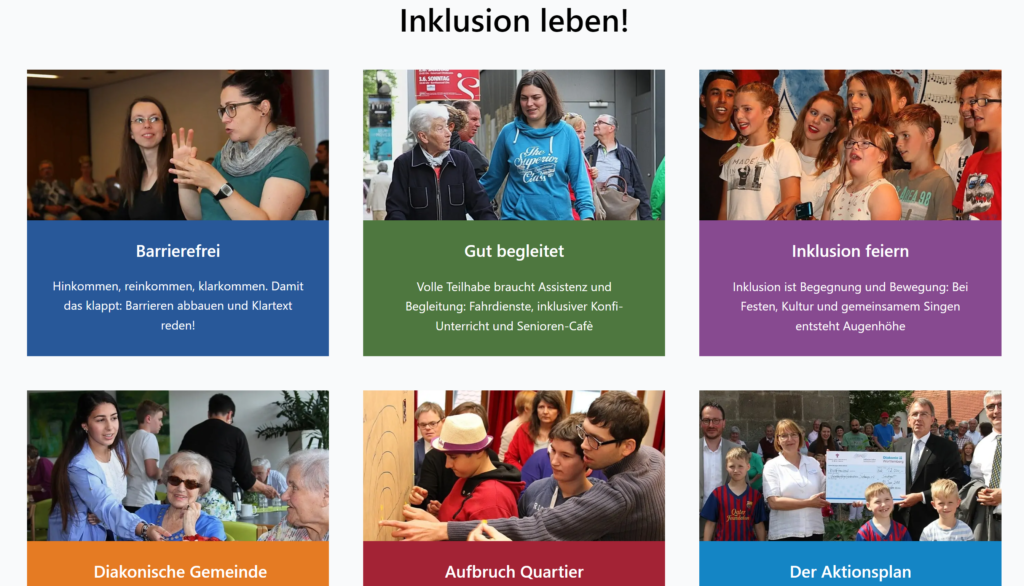Grundlagentexte
Einfach dazugehören. Das heißt: teilhaben können ohne Wenn und Aber. Inklusion zielt auf die Anerkennung von Menschen in ihrer Einmaligkeit und Verschiedenheit. „Es ist normal, verschieden zu sein“, hat Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1993 formuliert. In diesem Bereich der Website finden Sie Handreichungen und Tipps über die Grundlagen von Inklusion und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten in Kirche und Diakonie.
Diskriminierung durch Sprache
Sprache schafft Wirklichkeit. Durch Sprache können vorherrschende Strukturen verfestigt, aber auch gelockert werden.
Wir möchten nicht, dass sich Menschen durch die hier verwendete Sprache ausgeschlossen oder nicht angesprochen fühlen. Aus diesem Grund nutzen wir im Fließtext den Gender-Doppelpunkt. In den Überschriften verwenden wir die ausgeschriebene weibliche und männliche Form.

Handreichungen
Offene und einladende Kirchgemeinde sein. Inklusion als Gemeindeentwicklung
Diese Handreichung zeigt mit gut verständlichen Anleitungen in Text und Bild den Weg zu einer inklusiven Kirchgemeinde, die ihre Türen öffnet und in der Menschen willkommen sind.
Die Handreichung hat drei Teile:
- Zugänge: mit Anregungen zu Zielen und Visionen der Gemeindeentwicklung
- Fragen: als konkretes Arbeitsmittel, durch das Sie in kleinen Schritten Türen öffnen können
- Methoden: um mit den Fragen arbeiten zu können
Hrsg.: Evangelisch-Lutherische Kirche Sachsens (2021)
Internetportal mit Broschüre „Menschen. Leben. Vielfalt – Facetten einer inklusiven Kirchengemeinde“, Fragebögen und Checklisten
Die Broschüre „Menschen. Leben. Vielfalt – Facetten einer inklusiven Kirchengemeinde“ der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau lädt Kirchgemeinden, Einrichtungen und Nachbarschaften ein, sich auf den Weg der Inklusion zu machen. Dabei sind die Potentiale von schon gelingender Inklusion im Blick und es werden neue Wege und Ideen Vorgestellt und gezeigt. Als Facetten werden die Bereiche Haltung, Sehen, Hören, Verstehen, Willkommen sein, Gerechtigkeit, Bildung und Feiern benannt und ausgeführt. Jede Gemeinde kann selbst entscheiden, in welchem Bereich sie aktiv wird.
Die Broschüre ist in schwerer und leichter Sprache zum Herunterladen verfügbar.
Hrsg.: Zentrum Seelsorge und Beratung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (2022)
Hilfreich sind die 9 Inklusionsfacetten, hinter denen Fragebögen und Checklisten zu einzelnen Bereichen aufrufbar sind.
Fragensammlung zur Partizipation
Menschen mit und ohne Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung haben ausgehend von ihren Erfahrungen und ihrer Expertise gemeinsam die Fragensammlung „Mitbestimmen! Fragensammlung zur Partizipation“ erarbeitet. Die Fragensammlung unterstützt dabei, Partizipation in Organisationen der Eingliederungshilfe und Sozialpsychiatrie und in Kommunen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Im Fokus steht die Partizipation von Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischer Beeinträchtigung oder hohem Unterstützungsbedarf.
Hrsg.: Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB) (2021)
Neue Ansätze zu einer Theologie der Inklusion
Inklusion ist verwirklicht, wenn alle dazugehören. Aber woran merken wir, dass jemand dazugehört? – Daran, dass er oder sie vermisst wird. Das wird in dieser Handreichung theologisch begründet. Über Erfahrungen von Menschen aus der Entwicklungsarbeit und der Kirche in Deutschland und der Schweiz wird berichtet. So will die CBM Impulse geben, dass gemeinsam weitere gute Schritte gegangen werden – hin zu einer inklusiven Kirche.
Hrsg.: CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.
Werkzeugkoffer Barrierefrei beraten
In der württembergischen Landeskirche und ihrer Diakonie gibt es eine Vielzahl von Beratungsangeboten. Diese sind aber bisher nicht in gleicher Weise für alle Menschen zugänglich. Dank der Unterstützung durch den Aktionsplan „Inklusion leben“ konnte an den drei Standorten Blaubeuren, Heilbronn und Schwäbisch Hall der Weg zu einer barrierefreien Beratung beispielhaft beschritten werden. Aus den gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse ist ein „Werkzeugkoffer“ entstanden.
Hrsg.: Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. u.a. (2021)
Teilhabe und Vielfalt: Arbeitshilfe zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und zur Verwirklichung von Inklusion
Diese Arbeitshilfe der Diakonie Sachsen wurde bereichsübergreifend unter Beteiligung zahlreicher Praktiker:innen von den Diakonischen Einrichtungen und Diensten erarbeitet. Die Arbeitshilfe beschreibt sehr kurz das gemeinsame Inklusionsverständnis der Beteiligten und gibt praktische Tipps in Form von Check-Listen, Indexfragen, Handlungsstrategien und Praxisbeispielen. Dies erfolgt jeweils in drei Themenschwerpunkten, der Bewusstseinsbildung, der Beteiligung, der Sozialraumorientierung und der Barrierefreiheit.
Hrsg.: Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsen e.V. (2017)
Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion leben in Kirche und Gesellschaft
Eine umfangreiche Orientierungshilfe zur Inklusion von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Wer sie zur Hand nimmt, erhält einen breiten Überblick über die verschiedenen Gesichtspunkte des Themas.
Dazu gehören beispielsweise eine theologische Orientierung oder die Beschreibung, was Inklusion für die Bereiche Bildung, Wohnen, Arbeit usw. bedeutet. Die Orientierungshilfe erblickt in der Inklusion eine Chance für Kirche und Gemeinde. Diese Möglichkeiten werden für verschiedene Gemeindebereiche wie Gottesdienst, Seelsorge oder Kinder- und Jugendarbeit erläutert.
Hrsg.: Evangelische Kirche in Deutschland (2015)
Da kann ja jede(r) kommen. Inklusion und kirchliche Praxis
„Was gibt Ihnen das Gefühl, dazu zu gehören?“ „Können alle Menschen in der Gemeinde das Gefühl haben, dass sie mit ihren Fähigkeiten gesehen werden?“ „Wird die Bibel genutzt, um sich die Situation von Menschen bewusst zu machen, die von Ausgrenzung bedroht sind?“
Fragen wie diese öffnen den Weg zu Erfahrungen, die Menschen mit einer Kirchgemeinde machen. Sie eignen sich deshalb auch als Ausgangspunkt, um die Kirchgemeinde einladender zu machen. Mit der Handreichung hat die Rheinische Landeskirche ein Arbeitsmaterial veröffentlicht, das allen Gruppen in der Kirchgemeinde Anregungen für inklusive Veränderungen gibt. Anhand vielfältiger Fragen können sie ihre eigenen Stärken und Schwächen erkennen und Veränderungsziele gemeinsam bestimmen.
Hrsg.: Evangelische Kirche im Rheinland (2013)
Praxisbeispiel
Die Ev. Landeskirche in Württemberg und ihrer Diakonie hat eine umfangreiche Website mit vielen grundlegenden Informationen und zahlreichen Praxisbeispielen: https://inklusion-leben.info/
Literaturhinweise
Alle Titel sind in der Bibliothek des Landeskirchenamtes ausleihbar.
- Johannes Eurich; Andreas Lob-Hüdepohl (Hrsg.): Inklusive Kirche, Stuttgart: Kohlhammer 2011
- Ralph Kunz; Ulf Liedke (Hrsg.): Handbuch Inklusion in der Kirchengemeinde, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013.
- Dorothea Lampke; Albrecht Rohrmann; Johannes Schädler (Hrsg.): Örtliche Teilhabeplanung mit und für Menschen mit Behinderungen, Wiesbaden: Springer 2011